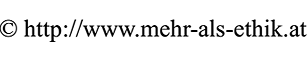
Von Sabine Zelger
Auseinandersetzungen mit Bioethik basieren in der Regel auf der Frage, wie wir leben wollen. Dabei geht es um das „richtige“ Handeln für Institutionen, EntscheidungsträgerInnen sowie für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Aber sind alle Gruppen unserer Gesellschaft gleichermaßen eingeladen und dazu imstande, hier mitzudiskutieren? Und sind alle in gleicher Weise dazu befähigt, die ethischen Entscheidungen zu realisieren? Auch im aktuellen Gesundheitsdiskurs ist die Individualisierung von Aufgaben und Pflichten verankert, obwohl nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben, sie zu erfüllen. So sind wir zur ständigen Selbst- und Vorsorge aufgerufen, darüber hinaus wird Entspannung und Erholung von uns verlangt. Aber inwiefern verfügen wir überhaupt über die Möglichkeit, diesen Anleitungen zu folgen bzw. sie in Frage zu stellen?
Wenn es um die zentrale Frage der Ethik geht, wie wir leben wollen und sollen, muss immer auch die Frage nach den Bedingungen gestellt werden, in denen wir leben (vgl. Zelger 2012, 57). Dazu müssen Gruppen der Gesellschaft differenziert betrachtet und Diskriminierungen und Nachteile, von denen bestimmte Personen betroffen sind, unter die Lupe genommen werden. Lange Zeit wurden diese Fragen getrennt nach Klasse, Rasse und Geschlecht beantwortet und Benachteiligungen beispielsweise bei ArbeiterInnen, Schwarzen oder Frauen ausgemacht. Dass eine derartige Wahrnehmung nicht genügt, wurde in den 1980er Jahren von schwarzen US-Amerikanerinnen festgestellt, die sich dem Feminismus weißer Mittelschichtfrauen nicht zugehörig fühlten und damit die Intersektionalitätsdebatte auslösten. Intersektionalität bezeichnet den Zusammenhang und die Verwobenheit diskriminierender Faktoren. Sie können zur Mehrfachbenachteiligung führen, wie bei schwarzen Arbeiterinnen in den USA, sie können aber auch die Unsichtbarkeit von Benachteiligungen zur Folge haben, weil bestimmte Diskriminierungen etwa als „Frauenproblem“ abgetan werden, obwohl sie beispielsweise auf rassistischen Gründe beruhen (vgl. Knapp 2010).
Welche Faktoren werden nun berücksichtigt? Zu den drei zentralen Kategorien werden nach wie vor race, class und gender gezählt (vgl. Klinger u.a. 2007). Die Kategorien können aber je nach Thema und Frageinteresse erweitert werden. So sind es bei Aspekten wie Körper und Gesundheit vor allem die Kategorien Alter, Körpernorm und sexuelle Orientierung, die einer näheren Betrachtung bedürfen.
Um strukturelle Privilegien und Benachteiligungen in den Blick zu bekommen, kann sowohl bei Literatur und Filmen als auch bei Interviews, persönlichen Einschätzungen oder Studienergebnissen nach Überkreuzungen von Diskriminierungen bzw. Ungleichheitslagen gefragt werden:
In der Intersektionalitätsforschung werden zwei Ebenen unterschieden, auf der Diskriminierungen stattfinden und analysiert werden können (Winker/Degele 2009, 18ff.).
Auf der Makroebene geht es um Organisationen und Institutionen sowie um soziale Strukturen. Ins Auge gefasst werden finanzielle, rechtliche und soziale Bedingungen, die zum Beispiel berufliche Aufstiegs-, Betreuungs-, persönliche Entfaltungsmöglichkeiten regeln. Manchmal sind diese Zugänge offiziell eingeschränkt und bestimmte Personengruppen, wie beispielsweise Drittstaatsangehörige oder Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen, sind rechtlich von Zugängen ausgeschlossen. Manchmal sind Diskriminierungen subtil, wenn etwa Personen ab einem bestimmten Alter, mit anderer religiöser, sexueller Orientierung und/oder anderer Hautfarbe irgendwie nicht zum Zug kommen. (siehe Materialien wie 41 % Behinderte?, Blickwechsel und Ein bescheidener Vorschlag)
Will ich erfahren, wie diese Ungleichheiten und Diskriminierungen entstehen, so betrachte ich die Mikroebene. Dort geht es um Interaktionen zwischen Personen und die Konstruktion sozialer Identitäten. Die Frage ist, mit welchen Attributen und Bewegungen bestimmte Subjektpositionen zum Ausdruck gebracht werden: Gesten, Kleidung, Essgewohnheiten etc. Was wird hier als normal angesehen? Was wird sanktioniert? Welche Kleidung, welche Bewegung, welches Auftreten erwartet die Mehrheitsgesellschaft von einer älteren Frau, einem pflegebedürftigen Asylwerber, einer österreichischen Gesundheitsministerin? Und was passiert, wenn sich Menschen nicht an diese sozialen Regeln halten? (siehe Materialien wie Körper und Macht, Dirty old (Wo)men? und Eine Norm fürs Normale?)
Mittels symbolischer Repräsentationen – Erzählungen, Ausdrücke, Darstellungen – gehen diese Erwartungen ins Alltagswissen ein. Sie werden normiert und fixiert und wirken als selbstverständliche, alternativlose Maßstäbe. Manche Bilder oder Begriffe setzen sich leichter durch und verdrängen oder verhindern andere. So stellt sich hier die Frage, welche Gruppen (mit welchen Merkmalen) über Deutungsmacht verfügen und welche Gruppen ausgeschlossen oder kaum vernehmbar sind. Gefragt werden kann aber auch danach, wie Mehrfachprivilegien (gute berufliche Stellung, kein Migrationshintergrund, Hetero etc.) und Mehrfachbenachteiligungen (Arbeit mit geringer oder ohne Bezahlung, Behinderung, Hochaltrigkeit) zur Sprache gebracht bzw. ins Bild gesetzt werden (siehe Materialien wie Altersvielfalt aus Betroffenensicht und Krampfkampf Pflegesystem).
Literatur
Klinger, Cornelia/Knapp, Gudrun-Axeli/Sauer, Birgit (Hg.) (2007): Achsen der Ungleichheit. Zum Verhältnis von Klasse, Geschlecht und Ethnizität. Frankfurt am Main/New York.
Knapp, Gudrun-Axeli (2010): „Intersectional Invisibility“. Anknüpfungen und Rückfragen an ein Konzept der Intersektionalitätsforschung. In: Helma Lutz/Maria Teresa Herrera Vivar/Linda Supik (Hg.): Fokus Intersektionalität. Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzepts. Wiesbaden (= Geschlecht & Gesellschaft, Bd. 47), 223–243.
Winker, Gabriele/Degele, Nina (2009): Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten. Bielefeld.
Zelger, Sabine (2012): Die Gesundheit zum Leben oder zum Tod. Intersektionalität als unverzichtbare Dimension bioethischer Auseinandersetzung. In: Doris Pfabigan/Sabine Zelger (Hg.): Mehr als Ethik. Reden über Körper und Gesundheitsnormen im Unterricht. Wien, 55–63.